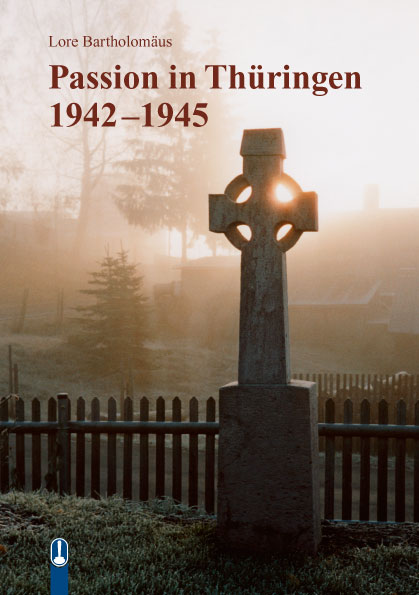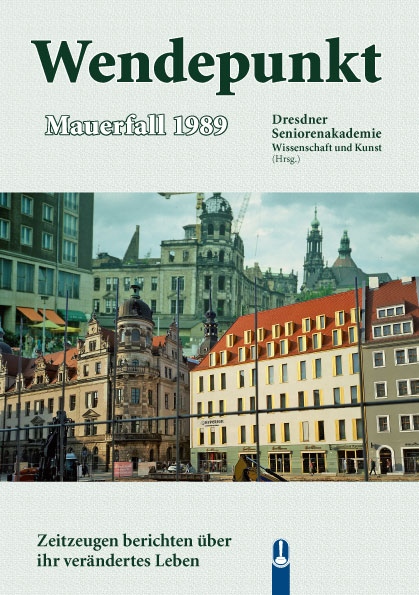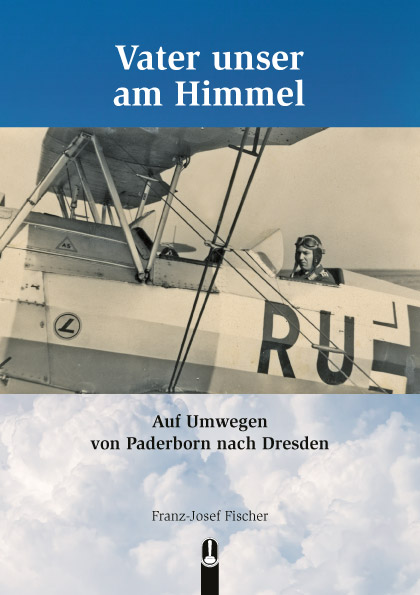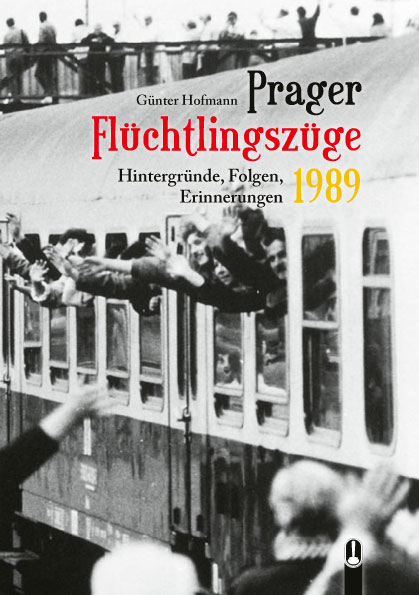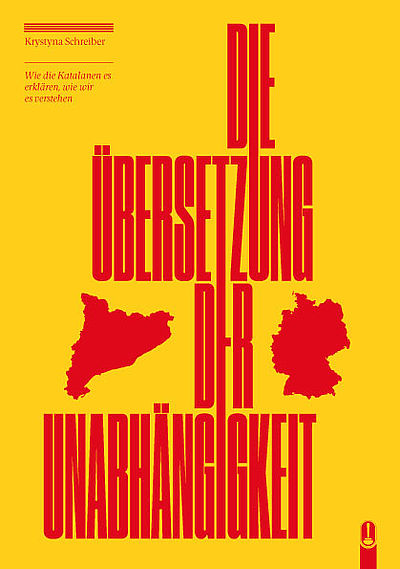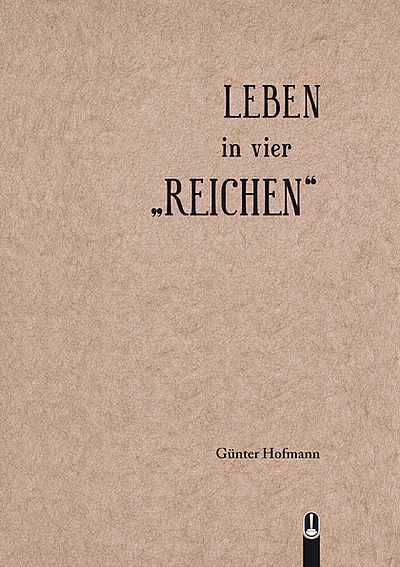Passion in Thüringen 1942–1945
Junge französische Zwangsarbeiter im geistlichen Widerstand:
Glaubenszeugen und Wegbereiter der Versöhnung
von Lore Bartholomäus
Details zum Buch:
Seitenanzahl: 116
Erscheinungsjahr: 2010
Format: 14,8 cm x 21,0 cm
Einband: Broschur
| Gewicht | 0,27 kg |
|---|
9,80 € (inkl. MwSt., zzgl. Versand)
Hinführung:
Der Kreuzweg junger Franzosen in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs
Mitten im Zweiten Weltkrieg, im Juli 1943, als die deutsche Besatzung in Frankreich das Land peinigte, wurden Hunderttausende junger Franzosen mit Hilfe der gnadenlosen Organisation von Zwangsarbeit durch den dafür Bevollmächtigten Fritz Sauckel nach Deutschland deportiert. Sie mussten dort in Fabriken Waffen herstellen und in der Landwirtschaft, in Gärtnereien und anderen Betrieben mitarbeiten, um die deutschen Männer an der Front und die schon im Krieg Getöteten zu ersetzen. Man log ihnen vor, die könnten durch ihren Einsatz französische Kriegsgefangene auslösen. So kamen viele „freiwillig“.
Mit ihnen solidarisierten sich junge Ordensleute, Studenten der Theologie und Seminaristen in der Vorbereitung auf ihren Beruf als Geistliche und einige bereits geweihte katholische Priester, um ihnen beizustehen, ihren Lebensmut zu stärken, ihnen das Evangelium zu bringen und damit die Kraft zum Widerstehen und Durchhalten. Sie wirkten wie Sauerteig unter der Masse der Arbeiter, die zum großen Teil dem Christentum völlig entfremdet waren und nun in der Fremde erneut Zugang fanden in einer niederdrückenden Situation, in der sie empfänglich waren für Ermutigung, Trost, Hoffnung auf Heimkehr, aufrichtige Freundschaft und Stärkung ihrer Widerstandskraft.
Durch die Einführung des „Service du Travail Obligatoire“ (STO = Zwangsarbeits-Verpflichtung) am 16. Februar 1943 wurden alle männlichen Jugendlichen, die zwischen dem 1. Januar 1920 und dem 31. Dezember 1922 geboren wurden – später ausgeweitet auf das letzte Vierteljahr 1919 – , zur Arbeit in Deutschland gezwungen. Wer sich durch Verstecken entziehen wollte, nahm den Gewissenskonflikt auf sich, seine Familienangehörigen der Willkür der Machthaber auszuliefern. Deshalb haben viele auf die Möglichkeit der Flucht verzichtet oder sind sogar stellvertretend für junge Freunde, die bereits Frau und Kinder hatten, ins Land der Besatzer gegangen, einige von ihnen in den bitteren Tod in grausamen Lagern.
Nur einer von ihnen ist in der Öffentlichkeit bekannt geworden: Marcel Callo. Aber auch die anderen, die genauso gelitten haben und ebenso aufrecht ihren Weg gegangen sind, dürfen nicht vergessen werden. Sanguis martyrum – semen christianorum (Tertullian): Das Blut der Märtyrer ist der Same für neue Christen. So glaubt und vertraut die Kirche von Anfang an; so hat sie es im Lauf ihrer Geschichte immer wieder erfahren. Die jungen französischen Christen haben den geistigen Grund gelegt für die Verständigung zwischen Jugendlichen aus Frankreich und Deutschland, die sofort nach dem Krieg bereit waren, die jahrhundertealte Feindschaft zwischen beiden Völkern zu beenden und sich die Hände zu reichen. Es ist vor allem ihnen zu verdanken, dass aus „Erbfeinden“ Freunde geworden sind, die an der friedlichen Zukunft Europas weiterbauen. Sie haben den späteren politischen Entwicklungen und Entscheidungen, etwa durch Robert Schuman und Konrad Adenauer, die innere Nahrung gegeben, verborgen, aber in der Tiefe wirksam.
In der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Oberpfalz, sind in dem großen, schweren schwarzen Buch der Namen auch die der acht jungen Franzosen zu finden, die von Thüringen aus entweder vorübergehend dort waren oder dort auch gestorben sind:
– Henri Marrannes
– die Brüder André und Roger Vallée
– Louis Pourtois
– Camille Millet
– Marcel Callo
– Marcel Carrier
– Jean Tinturier
Auf ihren Spuren zu gehen, ihre Beweggründe für ihre tapfere „résistance spirituelle”, ihren geistig-geistlichen Widerstand gegen den Ungeist des Naziregimes, besser zu begreifen und ihre jugendliche Leidenschaft für Christus und sein unzerstörbares Reich tiefer zu ermessen, waren meine Motive dafür, vom Mittwoch der Karwoche 2010 bis zum Ostermontag in Flossenbürg zu sein, dort die Liturgie dieser wichtigsten Tage des Kirchenjahres in der Gemeinde St. Pankratius mitzuerleben und fast täglich mehrere Stunden auf dem Gelände des Lagers zu verbringen. So verband sich für mich die Passion Jesu von selbst mit der Passion jener jungen Männer, die Jesus bewusst nachgefolgt sind und bereit waren zu sterben aus Liebe zu Ihm und zu den erlösungsbedürftigen Menschen; wie ER ohne Hass, sondern für die Peiniger betend. Auch das Fest seiner Auferstehung in der Osternacht verband sich mit der Hoffnung auf ihre Vollendung und Auferstehung im Licht unendlicher Herrlichkeit. Deshalb wechseln im Text Teile der Leidensgeschichte aus den Evangelien mit den Lebensbildern der französischen Glaubenszeugen, Eindrücke von der Gedenkstätte mit dem Erleben der Liturgie in der Dorfkirche. Ungefähr um die gleiche Jahreszeit, am 9. April 1945, wenige Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wurden in Flossenbürg der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer und andere bekannte Persönlichkeiten des Widerstands gegen die Nazidiktatur durch den Strang ermordet. Sie haben nur eine Nacht im Konzentrationslager Flossenbürg verbracht. In einer Scheinverhandlung, deren Ergebnis vorher feststand, waren sie zum Tode verurteilt worden. Der Innenhof des Arrestbaus, wo sie starben, steht zum Teil noch. Die Henker, die Erfüllungsgehilfen waren, kennt niemand mehr; aber die Getöteten sind in ihren Briefen und Büchern, ihren Bildern und Gedanken lebendig und machen Mut. Bonhoeffers Gedicht von der Geborgenheit durch gute Mächte, das er an Silvester 1944 seiner Braut Maria von Wedemeyer aus dem Gefängnis in Berlin geschickt hatte mit der Bitte, es an seine Familie weiterzugeben, ist mehrfach vertont worden und als Allgemeingut christlicher Gemeinden in vielen Liederbüchern zu finden. Seine Theologie wirkt bis heute nach und stärkt Menschen, wach und bereit zum Widerspruch gegen Unrecht zu denken und zu handeln. Ein Freund von ihm überlieferte die letzten Worte, die Dietrich Bonhoeffer zusammen mit Grüßen an einen befreundeten anglikanischen Bischof in England aussprach, bevor er wissend und bereit in den Tod ging: „Das ist das Ende – für mich der Beginn des Lebens.“ Im Morgengrauen des 9. April 1945 vollzog sich in Flossenbürg die scheinbare Vernichtung der Männer, die keinesfalls überleben sollten. Der Lagerarzt, der schon viele Menschen hatte sterben sehen, war bewegt vom Anblick des Häftlings Bonhoeffer, der in der Vorbereitungszelle kniete und betete. Die Ausstellung zu seinem Leben und Wirken an eben diesem Ort vom März bis September 2010 zeigte, dass sein Erbe lebendig bleibt.
Die Asche der verbrannten Toten wurde im abschüssigen Gelände beim Krematorium vergraben, verscharrt oder einfach liegen gelassen, bis Wind und Wetter sie auflösten. Keiner der Ermordeten hat ein Grab, an dem Angehörige und Freunde einen Ort der Trauer finden könnten. Und doch bleibt ihr Leben unvergessen. Das hebräische Wort für „Gedenke!“, ist an mehreren Stellen des Geländes zu finden, auch das lateinische „Memento“ und das italienische „Ricordo“. Ähnliche Worte in vielen Sprachen beschwören die Gegenwart der Toten.
Juden und Christen aller Konfessionen dürfen glauben und hoffen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern ER, der jeden einzelnen dieser Menschen ins Leben gerufen und zu Seiner Herrlichkeit berufen hat. So möchte dieser Versuch einer Zusammenschau der Leidenswege vom Abendmahlssaal, dem „Obergemach“, bis zur Auferstehung zu verwandeltem neuen Leben denen Dank sagen, die ihre je eigenen Kreuzwege auf sich genommen haben, und Dem zu danken, der sie dazu befähigt hat. ER kennt auch die unzähligen Menschen, deren Namen niemand mehr weiß, die in keinem Gedenkbuch und auf keinem Denkmal stehen, sondern deren Träger im Strudel der Ereignisse mit gerissen wurden und verschwanden. Für sie alle gilt, was nach einem jüdischen Brauch Trauernde beim Verlassen des Friedhofs beten, während sie sich die Hände waschen:
„Verschlingen lässt ER den Tod in der Dauer, Abwischen wird mein Herr, ER, von alljedem Antlitz die Träne, und die Schmach seines Volkes abtun von allem Erdland. Ja, geredet hat´s ER.“
Dem Direktor des Thüringischen Staatsarchivs Meiningen, Dr. Johannes Mötsch, der diese Arbeit angeregt, begleitet und unterstützt hat, sage ich aufrichtigen Dank, ebenso allen, die auf vielfältige Weise zum Gelingen beigetragen haben.
Christes/Thüringen, am Fest der heiligen Märtyrer
John Fisher (1469–1535) und Thomas More (1478–1535),
dem 22. Juni 2010
L. B.